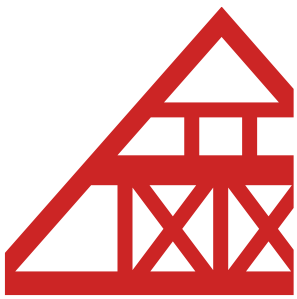Himmlisch schlafen im Himmelbett?
Himmelbett aus dem Raum Geslau, „1836“, Inv.-Nr. 14/284; 2014 vom Stadtmuseum Leutershausen übernommen. (Foto: Monika Runge)
Mit ihren Säulen und dem hölzernen „Himmel“ machen sie schon etwas her – Himmelbetten wirken mächtig und vornehm, besonders in Bauernhäusern mit niedrigen Decken und kleinen Schlafkammern. Tatsächlich ist der Aufbau des „Himmels“, auch Baldachin genannt, mehr praktisch als repräsentativ. Putzstücke, Dreck und Ungeziefer fallen so nicht ins Bett. An den Seiten waren oft noch Vorhänge angebracht, die ebenfalls Mücken fernhielten und zur Privatsphäre beitrugen. Zwischen den Pfosten konnte man Tuchwiegen für Säuglinge aufhängen. Von Komfort, Hygiene oder Intimität nach heutigen Maßstäben kann dennoch keine Rede sein.
Himmelbetten waren vom Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert weit verbreitet und durchaus auch in einfacheren bäuerlichen Haushalten zu finden. Doch mehr als ein Himmelbett stand in der Regel nicht im Haus, und das blieb dem Hausherrn und seiner Frau vorbehalten. Breite Betten für zwei Personen bezeichnete man übrigens auch als „zweischläfrige Betten“ – das großflächige Ehebett im heutigen Sinne gab es noch nicht.
Himmelbetten wurden gern aufwendig verziert. In der Ära der bemalten Möbel im 18. und 19. Jahrhundert erhielten sie eine besonders farbenfrohe Gestaltung, kombiniert mit Namen, Initialen, Jahreszahlen und Sprüchen. Sie waren oft Teil der Aussteuer, die die Braut mit in die Ehe brachte – und ein echter Hingucker auf dem Kammerwagen, mit dem die besagte Aussteuer demonstrativ zum gemeinsamen Haushalt gefahren wurde.
Das hier gezeigte Himmelbett stammt aus der Gegend um Geslau, westlich von Ansbach gelegen. Es wurde anlässlich der Hochzeit von Maria Elisabetha Stark und Johann Leonhard Reichert im Jahr 1836 angefertigt, die beide in Schwabsroth lebten. Der Spruch auf dem Kopfteil unterstreicht das frische Liebesglück (oder die Hoffnung, dass sich selbiges alsbald einstellt): „Ich habe nun gefunden, was ich sucht manche Stunden, wornach mein Herz schon lange tracht, daß habe ich jetzt alle Nacht. Mann komm her und laß dich küssen, die Leute müssen es nicht wissen.“
Himmelbetten können Sie in mehreren Häusern des Fränkischen Freilandmuseums sehen – besonders schöne im Amtshaus aus Obernbreit, im Köblerhaus aus Oberfelden und im Bauernhaus aus Gungolding.
Das Team Wissenschaft & Sammlung wünscht ein ausgeschlafenes Jahr 2025!
Literatur | Thomas Schindler: Bemalte Möbel aus Mittelfranken. Bestandskatalog des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim (= Schriften und Kataloge des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim, Band 88). Bad Windsheim 2021. | weiterf. Konrad Bedal, Herbert May, Beate Partheymüller: Aufgemöbelt! Die schönsten Möbel aus der Sammlung des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim (= Schriften und Kataloge des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim, Band 56). Bad Windsheim 2009. | Nina Hennig, Heinrich Mehl (Hg.): Bettgeschichte(n). Zur Kulturgeschichtes des Bettes und des Schlafens (= Arbeit und Leben auf dem Lande, Band 5). Schleswig 1997.