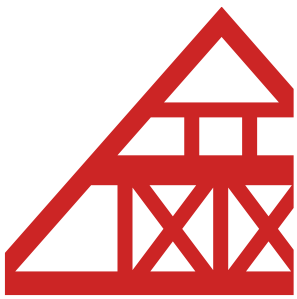Umwelt- und ressourcenschonend
Traditionelle Häuser mit ihren dicken Lehm- und Ziegelwänden können Wärme speichern, Luftzirkulation und Schatten wird durch Innenhöfe gefördert, Überhitzung wird durch kleine Fensterflächen reduziert. Die Ausstellung „Autochthone Architektur weltweit – was wir von unseren Vorfahren lernen können“ im Obergeschoss der Betzmannsdorfer Scheune des Freilandmuseums beschäftigt sich mit regionaltypischen Gebäuden in verschiedenen Ländern, die in der Vergangenheit mit Hilfe der verfügbaren Baumaterialien entstanden sind – bestmöglich an das jeweilige Klima angepasst.
Die Ausstellung ist das Ergebnis einer Analyse von historischen Gebäuden aus den Herkunftsländern von Studierenden des Masterstudiengangs „Healthy & Sustainable Building“ am European Campus Rottal-Inn der Technischen Hochschule Deggendorf. Erkundet werden können mehr als 50 Beispiele autochthoner Architektur, die hinsichtlich ihrer Baumaterialien, Bauphysik, Technik und Ökobilanz untersucht wurden. Beispiel Khiva, eine Stadt mit rund 90.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Usbekistan, deren historisches Zentrum 1990 in das UNESCO Welterbe aufgenommen wurde.
Als „architektonisches Juwel der Seidenstraße“ wird Khiva angesichts zahlreicher Baudenkmäler in der Ausstellung bezeichnet. Im Sommer können die Temperaturen bis zu 45 Grad betragen, im Winter bis zu minus 15 Grad, darauf wurde in der Vergangenheit reagiert mit Außenwänden und Fassaden aus Lehmziegel, Stampflehmwänden und Holz. Die Ökobilanz der historischen Baumaterialien im Vergleich zu modernen Materialien fällt eindeutig zu Gunsten der früheren Bauweise aus: „Der traditionelle Entwurf mit lokalen, wenig verarbeiteten Materialien führt insgesamt zu deutlich geringeren Emissionen“, heißt das Fazit für Khiva.
Zu der Ausstellung „Autochthone Architektur“ ist ein Begleitband erschienen.