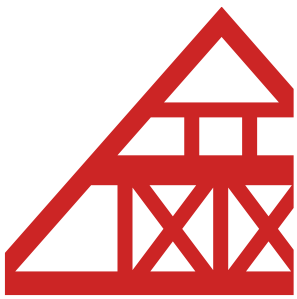Welch' eine Idylle! Motivteller mit Umdruckdekor
Motivteller mit ländlicher Dorfidylle in England, „The Copperfield“; ca. 1950er Jahre (?). Ein Stempel am Boden vermerkt: „English Style // FOUNDED 1731 (?) // HAND ENGRAVING // DECORATED UNDER GLAZE // […] // [L]UNEVILLE FRANCE“. Inv. Nr. 02/592. (Foto: Susanne Grosser)
Bezaubernde Landschaften, grandiose Bergpanoramen, beschauliches Leben am Fluss, zarte Romantik im Grünen: Vom oft schlicht weißen Alltagsgeschirr, das, wie im Blog schon berichtet, viele Regalfächer unserer Keramiksammlung füllt, heben sich einige Teller deutlich ab, die den Betrachter mittels eines einfarbig aufgedruckten Motivs in ein beinahe kitschig anmutendes ländliches Idyll entführen. Manchmal nehmen die Szenerien die gesamte Oberfläche des Tellers ein; häufig beschränken sie sich aber auch medaillonartig auf ein rundes Feld im Spiegel und werden dann durch ein ornamentales oder vegetabiles Muster auf der umlaufenden Fahne gleichsam eingerahmt. Bei einigen der Teller verrät eine Aufhängevorrichtung am Boden, dass sie einst als Wandschmuck dienten; bei anderen fehlt eine solche Vorrichtung, sodass wir nur mutmaßen können, dass sie einst an exponiertem Platz stehend der Zierde dienten.
Wie aber, d. h. mithilfe welcher Technik, kamen die oft sehr kleinteiligen und mit Liebe zum Detail angelegten Motive auf die Teller? Den „Trick“ dafür entwickelte man auf Basis einiger Vorläufer Mitte des 18. Jahrhunderts in England: das sogenannte Umdruckdekor (englisch: transfer printing). Dabei wird, vereinfacht beschrieben, das Motiv einer gravierten Kupferplatte, also eines Kupferstichs, mit einer Mischung aus Leinöl und Farbe zunächst auf ein Papier übertragen. Dieses Trägerpapier kann dann in einem zweiten Schritt, passend zugeschnitten, auf die Oberfläche der bereits erstmals gebrannten Keramik aufgelegt und das Motiv durch Anreiben des angefeuchteten Papiers so erneut „umgedruckt“, also weiterübertragen werden. Zunächst wurde das Verfahren als „Aufglasur-Umdruck“ eingesetzt, ab Ende des 18. Jahrhunderts dann vorwiegend „unter der Glasur“. Häufig verwendete Farben waren Schwarz, Rot und Blau, später mitunter auch Grün, Braun oder Rosa.
Auch in Kontinentaleuropa setzte sich die Umdrucktechnik im 19. Jahrhundert immer mehr durch und erfreute sich vor allem auf Geschirr aus Steingut lange sehr großer Beliebtheit. Selbst das ab Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt aufkommende neue Verfahren der Chromolithografie, also des Steindrucks, welches das Drucken mehrfarbiger Motive deutlich erleichterte, vermochte das Umdruckdekor auf Steingut nicht vollends zu verdrängen.
Nicht wenige der Motivteller mit Umdruckdekor aus der Sammlung des Freilandmuseums dürften – auch wenn eine sichere Datierung ohne Herstellermarke oft schwierig ist – sogar erst aus den 1950er und 1960er Jahren stammen. Zahlreiche derartige Teller in „Vintage-Optik“ werden bis heute zu meist recht günstigem Preis im Internet offeriert. Einen Platz in unserer Museumssammlung verdienen solche Objekte aber dennoch: nicht aufgrund ihres materiellen Wertes, sondern vielmehr als Zeugen des zeitgenössischen Geschmacks – also einer Wohnkultur, in der das ländliche Idyll noch immer seine Liebhaber fand.
Quellen | Andreas Heege: Beitrag „Umdruckdekor“. 2019. Online abrufbar unter: https://ceramica-ch.ch/glossary/umdruckdekor/ [letzter Aufruf: 03.06.2025]. | Ebenfalls online: https://printedbritishpotteryandporcelain.com/how-was-it-made/ [letzter Aufruf: 02.06.2025].